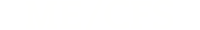Informationen für Abgeordnete, politisch Tätige und öffentlich wirkende Personen
Politik
Informationen für Abgeordnete, politisch Tätige und öffentlich wirkende Personen
Auf dieser Seite haben wir Informationen zusammengestellt, wie sich die gesundheitspolitische Situation für ME/CFS-Kranke effektiv verbessern lässt.
Was ist ME/CFS?
- Die Myalgische Enzephalomyelitis/das Chronische Fatigue Syndrom (kurz: ME/CFS) ist eine organische Erkrankung, die oft zu einem hohen Grad körperlicher Behinderung führt. Die WHO stuft ME/CFS seit 1969 als neurologische Erkrankung ein.
- ME/CFS-Betroffenen sind schwer krank und stark eingeschränkt. Ein Viertel aller Patient*innen kann das Haus nicht mehr verlassen, viele sind bettlägerig und auf Pflege angewiesen. Schätzungen zufolge sind über 60 % arbeitsunfähig.
- ME/CFS wird in der Mehrheit der Fälle durch Infektionserkrankungen ausgelöst (z. B. durch das Epstein-Barr-Virus, das Grippevirus oder SARS-CoV-2). Es finden sich Störungen in den Gefäßen, im Stoffwechsel und im Immunsystem. Der Krankheitsmechanismus ist noch nicht abschließend verstanden, einige Studien deuten auf Autoimmunität als mögliche Krankheitsursache hin.
- ME/CFS ist durch das Leitsymptom Post-Exertionelle Malaise (kurz: PEM) charakterisiert: Das bedeutet, Betroffene erleben nach einfachen Alltagsaktivitäten eine starke Verschlechterung ihres Zustands (Bewegung verschlimmert die Symptome), die in der Regel mehrere Tage, manchmal auch über Wochen oder dauerhaft anhält. Typisch für ME/CFS ist außerdem eine Orthostatische Intoleranz: Bei längerem aufrechten Sitzen oder Stehen verschlechtern sich die Symptome, weshalb Betroffene abhängig vom Schweregrad viel liegen müssen.
- ME/CFS ist eine relativ häufige Erkrankung. Weltweit waren vor der COVID-19-Pandemie etwa 17 Millionen Menschen betroffen, in Deutschland circa 250.000, darunter 40.000 Kinder und Jugendliche. Da eine große Subgruppe von Long COVID die Diagnosekriterien für ME/CFS erfüllt, wird aufgrund der Pandemie aktuell von einer Verdopplung der Zahl ME/CFS-Betroffener ausgegangen. So könnten aktuell in Deutschland etwa eine halbe Millionen Menschen an ME/CFS erkrankt sein.
Weitere ausführliche Informationen zum Krankheitsbild ME/CFS
Was ist das Problem?
Obwohl ME/CFS relativ häufig ist und zu den Erkrankungen mit der geringsten Lebensqualität zählt, erhalten die Betroffenen in Deutschland keine adäquate medizinische und soziale Versorgung. Die Dunkelziffer der Betroffenen ohne Diagnose ist hoch (ca. 90 %). Die Krankheit wird vom deutschen Gesundheitssystem seit Jahrzehnten nur unzureichend beachtet und nicht selten verharmlost. Infolgedessen werden Betroffene häufig in der Schwere ihrer Erkrankung nicht wahrgenommen und/oder fälschlicherweise als psychosomatisch erkrankt fehldiagnostiziert.
Aus psychischen oder psychosomatischen Fehldiagnosen folgen häufig kontraproduktive Aktivierungstherapien, die bei ME/CFS aufgrund der Post-Exertionellen Malaise schädlich sind und den Allgemeinzustand nachhaltig verschlechtern können.
Es gibt weiterhin nur wenige Ärzt*innen in Deutschland, die ausreichend über das Krankheitsbild informiert sind. Dadurch ist es für viele Erkrankte mit äußersten Schwierigkeiten verbunden, eine adäquate medizinische Diagnostik und Versorgung zu bekommen.
Angehörige müssen in vielen Fällen ihre schwerbehinderten Kinder, Partner*innen oder Eltern selbst pflegen, weil Pflegekassen die Schwere der Krankheit nicht anerkennen. Auch Anträge auf einen angemessenen Grad der Behinderung, Hilfsmittel oder Sozial- und Versicherungsleistungen wie eine Erwerbsminderungsrente, werden oft abgelehnt.
ME/CFS verläuft in den meisten Fällen chronisch. Nach wie vor gibt es aufgrund in der Vergangenheit fehlenden klinischen Studien für ME/CFS kein zugelassenes Medikament oder Heilung.
Warum ist die Erkrankung wenig erforscht?
ME/CFS wird im englischsprachigen Raum seit etwa 30 Jahren beforscht, allerdings verglichen mit anderen Erkrankungen in einem sehr geringen Umfang. In Deutschland hat die Forschung zu ME/CFS erst in den letzten 10 Jahren begonnen, im Jahr 2020 wurde erstmalig ME/CFS-Forschung aus öffentlicher Hand gefördert. Die Gründe für die bisher mangelnde Beforschung sind komplex: Zentral ist die fälschliche Psychiatrisierung und Psychosomatisierung der Krankheit, häufig einhergehend mit der Leugnung von ME/CFS als eigene klinische Entität. In Folge wird ME/CFS im Medizinstudium in der Regel nicht gelehrt, es mangelt an Fortbildungen und Universitätskliniken haben für ME/CFS-Betroffene keine Anlaufstellen zur Diagnostik, Therapie und Beforschung der Erkrankung. Durch die mangelnde Beforschung stehen wiederum keine validierten Biomarker oder zugelassenen Medikamente zur Verfügung.
Der Fall, dass unsere Selbstverwaltung von Medizin und Wissenschaft – wie bei ME/CFS – eine Krankheit übersieht, völlig falsch einordnet oder Patient*innen ignoriert, ist nicht vorgesehen und es gibt daher auch keine offiziellen Korrekturmechanismen; ME/CFS befindet sich in einem „toten Winkel“ des Gesundheitssystems.
Betroffene haben sich in den letzten 5 Jahren mit Protestaktionen trotz ihrer schweren Einschränkungen immer mehr Gehör verschafft und zusammen mit Medianauftritten der wenigen ME/CFS-Expert*innen mehr gesellschaftliches Interesse für die Krankheit und die Betroffenen erreicht. Die COVID-19-Pandemie hat durch die vielen neu an ME/CFS Erkrankten und den Fokus der Öffentlichkeit einen wichtigen Schub für die notwendige mediale Aufmerksamkeit gebracht.
Auch in der Politik ist das Thema angekommen: Mit der Verankerung von ME/CFS im Koalitionsvertrag der Ampelregierung und der Förderung der Nationalen Klinischen Studiengruppe sowie weiterer Forschungsprojekte wurden erste wichtige Schritte in Richtung einer besseren Versorgungssituation der Erkrankten gemacht. Die Not der Betroffenen ist jedoch nach wie vor riesig, sodass dringender politischer Handlungsbedarf besteht.
Wie kann die Politik der Notlage ME/CFS-Betroffener gerecht werden?
Verstetigung und Intensivierung der Forschungsförderung:
Bund und Länder haben zwischen 2020 und 2022 zusammen im Schnitt etwa 4 Millionen Euro pro Jahr in die ME/CFS-Forschung investiert. Unter Berücksichtigung der Krankheitslast wäre jedoch nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS eine jährliche Summe von 50 Millionen Euro angemessen (abgeleitet aus den Berechnungen von Mirin et al. (2020) für die USA). Von zentraler Bedeutung ist, dass das BMBF eine Anschlussfinanzierung der an der Charité Berlin laufenden Nationalen Klinischen Studiengruppe bereitstellt (Förderung läuft Ende 2023 aus) und die Fördersumme nach Möglichkeit erhöht, damit mehr klinische Studien mit Medikamenten durchgeführt werden können. Darüber hinaus sind (z. B. auf Länderebene) Ausschreibungen zu Förderungen biomedizinischer (!) Forschungsprojekte unbedingt sinnvoll, sowohl für Grundlagen- als auch für Therapieforschung.
Finanzierung von Kompetenzzentren:
Die Ampelregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag 2021 vorgenommen, für ME/CFS und Long COVID ein deutschlandweites Netzwerk an Kompetenzzentren zu schaffen. Bislang gibt es für ME/CFS nach wie vor nur eine einzige Ambulanz für Erwachsene (Charité Fatigue Centrum) und eine Ambulanz für Kinder und Jugendliche (MRI Chronisches Fatigue Centrum), beide Ambulanzen sind bisher nicht durch öffentliche Gelder abgedeckt. Damit weitere Ambulanzen mit Kompetenz für ME/CFS entstehen können, braucht es eine Anschubfinanzierung durch die öffentliche Hand. Die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS und Long COVID Deutschland haben im gemeinsamen Nationalen Aktionsplan vorgeschlagen, für die ersten 2 Jahre 15 Kompetenzzentren für Erwachsene mit 40 Millionen Euro zu finanzieren, sowie weitere 15 Kompetenzzentren für Kinder und Jugendliche mit 15 Millionen Euro.
Flächendeckende Aufklärung:
Unter Ärzt*innen und bei Gutachter*innen herrscht nach wie vor ein großes Wissensdefizit zu ME/CFS. Daraus resultieren Fehldiagnosen und Fehlbehandlungen, die den Zustand ME/CFS-Erkrankter dramatisch verschlechtern können. Daher sind kurzfristige Maßnahmen zur zielgerichteten Aufklärung und Sensibilisierung notwendig. Diese sollten insbesondere Hausärzt*innen, Rehaeinrichtungen, sowie Kranken-, Pflege- und Rentenkassen einbeziehen. Darüber hinaus ist eine Aufklärungskampagne auch für die breite Öffentlichkeit sinnvoll, da sich nach wie vor viele Menschen mit SARS-CoV-2 und anderen Viren wie der Influenza und dem Epstein-Barr-Virus infizieren und neu an Long COVID bzw. ME/CFS erkranken. Zentrale Botschaft in der Aufklärung der Ärzt*innenschaft und Öffentlichkeit sollte das Erkennen der Post-Exertionellen Malaise als Leitsymptom von ME/CFS sein, sowie das sich daraus ableitende Pacing als pragmatisches Krankheitsmanagement.
Nationaler Aktionsplan und Länderleitfaden geben weiterführende Orientierung:
Ausführliche weiterführende Informationen, wie die Politik aktiv werden kann, finden sich in dem von der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS und Long COVID Deutschland entwickelten Nationalen Aktionsplan sowie dem Länderleitfaden. Teil des Nationalen Aktionsplans sind einzelne Konzepte zu Versorgung, Forschungsförderung und Aufklärung. Der Länderleitfaden behandelt dieselben Themen und richtet sich an die Bundesländer sowie das Gesundheitswesen und die in der Forschung Tätigen insgesamt.