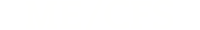Interview mit Regisseurin Daniela Schmidt-Langels
„den Vergessenen ein Gesicht und eine Stimme geben“
Daniela Schmidt-Langels ist die Regisseurin der Dokumentation „Die rätselhafte Krankheit – Leben mit ME/CFS“, die am 10. Juli auf ARTE ausgestrahlt wird. Im Interview mit der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS spricht sie darüber, wie der Plan entstand eine Dokumentation über ME/CFS zu drehen, was sie besonders überrascht hat und was die Dokumentation bewirken soll.
Möchten Sie sich kurz für unsere Leserinnen und Leser vorstellen?
Ich habe in Köln und Berlin Musikwissenschaft, Spanisch und Geschichte studiert. Seit 1991 arbeite ich als freie Journalistin u. a. für ZDF Frontal 21 und als Dokumentarfilmerin für ZDF, ARD, ARTE und 3sat. Außerdem realisiere ich Radio-Features für WDR, SWR, Deutschlandfunk und Deutschlandradio-Berlin. Ich habe zwei Töchter im Alter von 25 und 21 Jahren, die mittlerweile von zu Hause ausgezogen sind und studieren. Ich lebe mit meinem Partner in Berlin.
Sie sind schon lange in der Filmbranche tätig. Welcher war Ihr erster Dokumentarfilm?
Mein erster Dokumentarfilm war „Rosenstraße – wo Frauen widerstanden, Berlin 1943“, den ich 1992 für ARTE gedreht habe. Es geht hier um die erste und einzige öffentliche Protestaktion von nichtjüdischen Ehepartnerinnen und Müttern gegen die Deportation ihrer jüdischen Ehepartner und Kinder, die im Zuge der sogenannten Fabrikaktion im Februar 1943 verhaftet wurden und in das Verwaltungsgebäude in der Rosenstraße 2–4 gebracht wurden. Ca. 10 Tage lang standen die Frauen Tag und Nacht vor den Toren des Gebäudes und verlangten lauthals die Freilassung ihrer Liebsten – mitten im Herzen von Berlin. Und tatsächlich wurden alle Inhaftierten (ca. 2000 Menschen) nach und nach wieder freigelassen. Ob wirklich diese Protestaktion die Freilassung initiierte, darüber diskutieren Historiker bis heute. Fakt ist, dass die meisten der Gefangenen den Krieg überlebten. In meinem Film erinnern sich Zeitzeugen, die die drinnen gefangen waren und jene, die draußen vor den Toren standen, an diese Ereignisse. Die Regisseurin Margarethe von Trotta machte später aus diesem Stoff einen Kinofilm (2003).
Wie sind Sie auf das Thema ME/CFS aufmerksam geworden?
Im Februar 2020 nahm die Produzentin Anahita Nazemi (Kobalt Documentary GmbH, Berlin) zu mir Kontakt auf. Sie hatte in Zusammenarbeit mit der Filmemacherin Sibylle Dahrendorf, die selbst seit vielen Jahren an ME/CFS erkrankt ist, ein Exposé über ME/CFS für NDR/ARTE entwickelt. Da es Sibylle Dahrendorf aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich war und ist, diesen Film zu machen, fragte mich Anahita Nazemi, ob ich diesen Film machen möchte.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie etwas von dieser Krankheit gehört und war erstaunt und erschrocken zugleich, wie viele Menschen davon weltweit betroffen sind. Über die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS suchte ich nach Betroffenen, die an ME/CFS erkrankt sind, um direkt etwas über diese Krankheit und ihren Verlauf zu erfahren. Ich rechnete mit einer Rückmeldung von vielleicht 10–15 Betroffenen. Doch als sich innerhalb von nur zwei Tagen knapp 100 Menschen mit ausführlichen Berichten meldeten, begriff ich, wie groß die Not und Verzweiflung der Erkrankten sein muss und wie dringend notwendig ein solcher Film ist. Es war die Zeit des ersten Lockdowns, im März/April 2020, ich hatte plötzlich viel Zeit. Diese Zeit nutzte ich, um die ersten Vorgespräche mit Betroffenen per Telefon zu führen. Es waren für mich sehr berührende Gespräche und ich spürte, dass ich unbedingt diesen Film machen muss, um ihnen, den Vergessenen, ein Gesicht und eine Stimme zu geben.
Wie entstand der Plan, gemeinsam mit ARTE und dem NDR eine Dokumentation über ME/CFS zu drehen?
Die Produzentin Anahita Nazemi hatte nach Finanzierungspartnern bei ARTE gesucht und das Projekt diversen Redakteuren vorgeschlagen. Aber es war Claudia Cellarius vom NDR, die das Potenzial und die Relevanz des Projektes auf Anhieb erkannte und von Anfang an mit viel Engagement dabei war.
Für mich jedoch war es absolutes Neuland, eine Wissenschaftsdokumentation zu machen und dann noch über ein medizinisches Thema, das so komplex und kompliziert ist. Das war für mich die größte Herausforderung. Die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS war hier ein hilfreicher Ansprechpartner für meine Fragen zur Medizin und Wissenschaft. Auch Sibylle Dahrendorf hat mir immer wieder wertvolle Anregungen und Informationen geschickt. Klar war für mich aber von Anfang an, dass die Menschen, die von ME/CFS betroffen sind, im Zentrum des Films stehen sollten. Von ihren individuellen Biographien aus wollte ich zu den jeweiligen Forschungsschwerpunkten führen. Leider war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, in die USA zu Ron Davis und seinem Sohn Whitney zu fliegen. Aber wir konnten in Norwegen, Berlin, München und Würzburg drehen, um uns dem Stand der Forschung anzunähern.
Wie lange hat es von der Idee bis zur Ausstrahlung der Dokumentation gedauert?
Sibylle Dahrendorf schickte der Produzentin Anahita Nazemi und vielen anderen am 12.5.2019 eine Rundmail, in der sie (am internationalen ME/CFS-Tag) auf die Erkrankung aufmerksam machte. Als Anahita Nazemi sie anrief, erfuhr diese mit Schrecken, dass Sibylle Dahrendorf selbst seit ca. 4 Jahren an ME/CFS erkrankt war. Anahita Nazemi fing an zu recherchieren und schnell wurde ihr klar, dass sie dazu einen Film produzieren möchte. Bis dann die richtigen Partner für die Finanzierung gefunden waren, verging einige Zeit ... Es hat alles in allem also von der ersten Begegnung mit dem Thema bis zur Ausstrahlung am 10.7.2021 etwas mehr als 2 Jahre gedauert.
Hat sich Ihr Bild von ME/CFS über den Verlauf der Arbeit an der Dokumentation gewandelt bzw. hat Sie etwas besonders überrascht?
Ich habe im Februar 2020 zum ersten Mal von dieser Krankheit gehört, im Februar 2021 haben wir die Arbeit am Film abgeschlossen. Am Anfang war ich überwältigt und zum Teil auch überfordert von den vielen wissenschaftlichen Ansätzen, die mir extrem kompliziert erschienen, auch weil kein*e Forscher*in mir die endgültige Ursache für die Erkrankung nennen konnte. Jeder Wissenschaftler forscht an „seinem Thema“, eine umfassende Theorie, die alle Ansätze verbindet, scheint es noch nicht zu geben.
Überrascht hat mich vor allem, wie wenig Forschungsgelder insgesamt zur Verfügung stehen – national wie auch international. Dass ein Wissenschaftler wie Bhupesh Prusty private Zeit investiert, um die Rolle der Mitochondrien zu erforschen, die ja scheinbar eine Schlüsselfunktion in diesem gesamten System spielen, fand ich unglaublich. Erstaunlich für mich auch das geringe Interesse der Gesundheitspolitik an diesem Thema, dass es keine Pharmafirmen gibt, die bereit sind, Medikamente zu entwickeln, dass es für die Betroffenen keine medizinische und soziale Versorgung gibt, dass die Menschen einfach vergessen werden, allein gelassen mit ihren Schmerzen und in ihrer Situation, all das hat mich doch sehr, ja, erschüttert.
Die Protagonistinnen und Protagonisten der Dokumentation sind teils schwer erkrankt. Hinzu kommt die Besonderheit, dass durch das Leitsymptom Post-Exertional Malaise jede Überanstrengung – wie der Besuch eines Filmteams – eine Zustandsverschlechterung auslösen kann. Wie sind Sie und alle Beteiligten damit umgegangen?
Als ich meine allererste Verabredung mit einer Betroffenen für ein erstes telefonisches Vorgespräch hatte, habe ich bewusst 15–20 Minuten später angerufen. Ich wollte nicht aufdringlich wirken. Doch als sie mir dann im Gespräch erklärte, dass sie die ganze Zeit auf mich gewartet habe und dass dieses Warten allein schon Kraft und Anstrengung kostet, war mir klar, dass der Energiehaushalt der Betroffenen extrem begrenzt ist. Ich hatte bei all meinen Telefonaten immer große Sorge, dass diese Gespräche einen sogenannten „Crash“ auslösen (wie ich später erfuhr, sind auch manche gecrasht), aber alle haben mir fest versichert, dass ihnen dieser Austausch sehr wichtig ist und dass sie einen solchen Zusammenbruch „in Kauf nehmen“.
An dieser Stelle wurde mir aber klar, dass „normale“ Dreharbeiten mit ME/CFS-Betroffenen nicht möglich sein werden. Normalerweise dreht man 2–3 Tage mit einem Hauptprotagonisten in einem 50-60-Minuten-Film, von morgens bis abends. Ich wusste, dass das hier nicht möglich sein wird. Schon allein der Aufbau von Kamera, Licht und Ton für ein Interview würde so viel Stress auslösen, dass der/die Betroffene kaum mehr Energie haben wird für das Gespräch selbst. Also entschied ich, die Interviews per Zoom zu führen, zu einem Zeitpunkt, den die Betroffenen selbst bestimmen. Vor Ort haben wir dann „nur“ Bilder/Impressionen von den Protagonist*innen gedreht, die uns im Schnitt als visuelle Ebene für Kommentartexte oder Interviewpassagen dienten. Ansonsten haben die Protagonist*innen mit dem eigenen Handy selbst Aufnahmen gemacht, die sie mir zur Verfügung stellten. Auf diese Weise haben wir, trotz der sehr knappen Drehzeit, einen doch sehr nahen und intensiven Zugang zu den jeweiligen Protagonist*innen herstellen können.
Gab es Momente während der Dreharbeiten, die Ihnen besonders eindrücklich im Gedächtnis bleiben werden?
Das ist schwer zu beantworten. Jede Begegnung mit den Betroffenen, aber auch mit den Wissenschaftler*innen war intensiv und besonders.
Hat die Corona-Pandemie die Dreharbeiten beeinflusst?
Wir haben mehr oder weniger Glück gehabt! Der größte Teil unserer Dreharbeiten hat genau zu der Zeit stattgefunden, als es kurzfristig möglich war, wieder unkomplizierter zu reisen (wir haben von Anfang bis Mitte Oktober 2020 gedreht) und vor allem in den verschiedenen Kliniken drehen zu können, wie in der Berliner Charité, an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg oder im Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München. Das war ab November 2020 nicht mehr möglich. Die Dreharbeiten in Norwegen hat ein norwegischer Kameramann für uns übernommen, da konnten wir schon nicht mehr hin. Genauso wenig in die USA zu Ron Davis. Der hat aus Vorsichtsmaßnahmen überhaupt niemanden zu sich nach Hause gelassen, um seinen Sohn Whitney, der auch an ME/CFS erkrankt ist, nicht zu gefährden. Ron Davis selbst hat zu dieser Zeit auch nicht mehr im Labor gearbeitet.
Wann war Ihnen klar, dass auch Long COVID ein Thema der Dokumentation sein wird?
Als ich mit Frau Prof. Scheibenbogen von der Berliner Charité das Interview führte und sie auf die ersten Long-Covid-Fälle hinwies, die vergleichbare Symptome aufwiesen, wie ME/CFS-Erkrankte. Über die Seite von Long-Covid-Betroffenen machte ich einen kleinen Aufruf mit der Frage, ob jemand bereit sei, über seinen Krankheitsverlauf zu sprechen. Im Gegensatz zu meinem ersten Aufruf bei der ME/CFS-Community gab es hier allerdings kaum Rückmeldungen. Das hat mich doch etwas erstaunt. Nur ein einziger junger Mann war bereit, uns von seinem Krankheitsverlauf zu berichten (zwei weitere hatten erst zugesagt, dann aber kurzfristig wieder abgesagt). Er hatte sich schon im März 2020 mit Corona infiziert und ist heute schwer krank – er leidet unter den gleichen Symptomen wie schwer erkrankte ME/CFS-Patient*innen. Dass die Gesundheitspolitik hier nicht wachsam ist und nun üppig Forschungsgelder bereitstellt, das verwundert mich sehr. Denn wir sehen bei den ME/CFS-Erkrankten, welche fatalen Folgen diese Ignoranz für mehrere hunderttausend Menschen allein nur hier in Deutschland haben.
Was ist Ihr Wunsch, was die Dokumentation bewirkt?
Natürlich wünsche ich mir, dass dieser Film alle Verantwortlichen in der Politik aufweckt, dass endlich genügend Gelder für interdisziplinäre Forschung in großem Umfang bereitgestellt werden. Es kann nicht sein, dass Patient*innen bewusst oder aus Unwissenheit von behandelnden Ärzt*innen in die psychosomatische Ecke abgeschoben werden, dass ihnen Therapien verschrieben werden, die sie eher zerstören als ihnen helfen, dass Betroffene von Gutachter*innen gedemütigt werden, indem man ihnen einfach nicht glaubt und sie nicht ernst nimmt, dass die Betroffenen allein und verlassen hinter zugezogenen Vorhängen „dahinvegetieren“. Es muss etwas passieren und zwar sofort. Und jetzt kommen noch mehrere 10.000 Long-Covid-Patient*innen dazu, die ein ähnliches Schicksal erwartet. Das kann einfach nicht im Interesse von Politik und Gesellschaft sein.
Möchten Sie ME/CFS-Erkrankten und ihren Angehörigen gerne noch abschließend etwas mitteilen?
Ja, an dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei allen Menschen bedanken, die bereit waren, mir ihre Geschichte zu erzählen. Ich weiß dieses große Vertrauen sehr zu schätzen. Sie alle haben mir geholfen, diesen Film überhaupt machen zu können, denn ich hatte wirklich keine Ahnung, auf was ich mich da einlasse, was das für eine Krankheit ist. Jeder, mit dem/der ich gesprochen habe oder der/die mir Beschreibungen / Informationsmaterial / Fotos geschickt hat, hat dazu beigetragen, dass dieser Film zustande kommen konnte. Insofern betrachte ich diesen Film als einen Film von uns allen. Es war ein gemeinsamer Weg und ich hoffe, dass dieser Film Türen öffnet – wissend, dass ich in diesen 54 Minuten noch lange nicht die gesamte Krankheit, ihre Ursachen, die Forschung abbilden konnte. Aber vielleicht vermittelt er einen Eindruck von der traurigen Situation der betroffenen ME/CFS-Erkrankten, von der fatalen Forschungs- und Versorgungssituation, vielleicht setzt er endlich Taten in Gang. Das wäre schön.
Vielen Dank für das Interview!
Die ganze Dokumentation:
Redaktion: jhe, dha