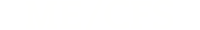Publikation: Warum die psychosomatische Sicht auf ME/CFS Betroffenen schadet
Titel der Publikation: Why the psychosomatic view on Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome is inconsistent with current evidence and harmful to patients
Autor*innen: Manuel Thoma (Deutsche Gesellschaft für ME/CFS), Laura Froehlich (FernUniversität in Hagen), Daniel B. R. Hattesohl (Deutsche Gesellschaft für ME/CFS), Sonja Quante (Deutsche Gesellschaft für ME/CFS), Leonard A. Jason (DePaul University, USA), Carmen Scheibenbogen (Charité Berlin)
Journal: Medicina / MDPI, Teil des Special Issue:
Advances in ME/CFS Research and Clinical Care: Part II, veröffentlicht am 31.12.2023
Thema: Die schädliche Wirkung psychosomatischer Krankheitsmodelle für ME/CFS-Betroffene sowie deren Unvereinbarkeit mit dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand
Art der Publikation: Meinungsartikel (Opinion letter)
Link zur Originalpublikation: https://doi.org/10.3390/medicina60010083
Anlass der Publikation
Obwohl in 30 Jahren ME/CFS-Forschung eine Reihe organischer Auffälligkeiten gefunden werden konnte (siehe Pathophysiologie von ME/CFS), ordnen einige Ärzt*innen die Krankheit nach wie vor als psychosomatisch bedingt ein. Die Fehleinordnung von ME/CFS geht häufig mit kontraindizierten aktivierenden Therapien einher, die aufgrund des Kardinalsymptoms der Post-Exertional Malaise (PEM) fatale Folgen für die Betroffenen nach sich ziehen können. Die Publikation zeigt auf, warum eine psychosomatische Sicht auf ME/CFS den Betroffenen gesundheitlich schadet und warum eine Psychosomatisierung der Symptome zur Stigmatisierung der Betroffenen beiträgt.
Zusammenfassung

Viele Krankheiten, die heute als organisch anerkannt sind, wurden lange Zeit als psychosomatisch eingeordnet. In den 50er-Jahren beschrieb Franz Alexander, einer der Gründungsväter der heutigen Psychosomatischen Medizin, die sogenannten „Holy Seven“: sieben Krankheiten, die er als psychosomatisch bedingt betrachtete, darunter Krankheiten wie Asthma bronchiale, rheumatoide Arthritis oder Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion). Heute werden diese Krankheiten aufgrund des Verständnisses ihrer organischen Genese nicht mehr als psychosomatisch angesehen. Bei Krankheiten, die weniger gut erforscht sind oder deren Forschungsstand Ärzt*innen weniger bekannt ist, sind psychosomatische Krankheitsmodelle aber immer noch weit verbreitet.
Die Art der psychosomatischen Fehleinordnung änderte sich bei ME/CFS im Laufe der Zeit: Im British Medical Journal wurde ME/CFS von zwei Psychiatern noch im Jahr 1970 als epidemische Hysterie beschrieben, da vor allem Frauen bzw. Krankenschwestern erkrankten. Inzwischen wurde das Krankheitskonzept der Hysterie aufgegeben und die Hysterie ist in der Internationalen Klassifikation der Krankheiten nicht mehr enthalten. Heutige psychosomatische Krankheitsmodelle, wie bspw. in der PACE-Studie postuliert, gehen von „dysfunktionalen Überzeugungen“ aus, die die Krankheitssymptome bei ME/CFS angeblich aufrechterhalten. ME/CFS-Betroffene erleiden nach diesem Modell Zustandsverschlechterungen aufgrund ihrer Erwartungshaltung (selbsterfüllende Prophezeiung) und nicht aufgrund krankhafter Prozesse in ihrem Körper. Das von ME/CFS-Betroffenen angewandte Pacing wird demnach nicht als überlebensnotwendiges Krankheitsmanagement angesehen, sondern als ängstliche Vermeidung von Aktivität interpretiert, wodurch der Körper dekonditioniert werde und dadurch die Symptome aufrechterhalten würden. Entgegen der Annahme solcher psychosomatischer Krankheitsmodelle finden sich zahlreiche und replizierte krankhafte organische Befunde bei ME/CFS, darunter schwere Kreislaufstörungen mit endothelialer Dysfunktion, einer verminderten Durchblutung von Gehirn und Muskulatur, Stoffwechselstörungen im Gehirn mit erhöhtem ventrikulären Laktat und auffälligen MRT-Befunden und eine Reihe von Studien, die einen Zusammenhang der Symptomausprägung mit Autoantikörpern gegen G-Protein-gekoppelte Rezeptoren zeigen. Während es keine empirische Evidenz gibt, die die Annahme „dysfunktionaler Überzeugungen“ stützt oder belegt, dass ME/CFS-Symptome durch Dekonditionierung verursacht werden, zeigen viele Studien, dass sich die Post-Exertional Malaise mit körperlichen Messungen objektivieren lässt. So belegen nach 24 Stunden wiederholte kardiopulmonologische Belastungstests, dass bei ME/CFS-Betroffenen die anaerobe Schwelle sowie die Sauerstoffkapazität beim zweiten Test im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant absinkt, was mit einer Vielzahl von auffälligen Biomarkern für Entzündung, Durchblutung und der Stressantwort einhergeht. Während Kontrollen mit bewegungsarmem Lebensstil nach einem wiederholten kardiopulmonologischen Belastungstest im Durchschnitt zwei Tage zur Erholung benötigen, brauchen ME/CFS-Patient*innen im Schnitt zwei Wochen. Im Einklang mit diesen Befunden zeigen Befragungen von ME/CFS-Betroffenen, dass gesteigertes körperliches Training (GET) bei vielen den Zustand nachhaltig verschlechtert.
Neben der gesundheitlichen Schädigung, die aktivierende Therapien wie GET bei ME/CFS verursachen, bewirkt die psychosomatische Zuschreibung der Symptome auch eine Stigmatisierung, die bei Betroffenen mit einer geringeren Lebenszufriedenheit und einer reduzierten Zufriedenheit in sozialen Beziehungen einhergeht. Psychosomatische Krankheitsmodelle suggerieren eine vermeintliche Kontrollierbarkeit der Symptome durch das eigene Verhalten und können damit Betroffene durch Erwartungen von Ärzt*innen oder dem sozialen Umfeld unter Druck setzen, die Symptomatik selbst zu verbessern. Wenn die falschen Erwartungen auf eine Verbesserung der Symptomatik dann an der Realität der Erkrankung scheitern, kann es zu Schuldzuschreibungen an die Betroffenen kommen, was die Situation für die Betroffenen noch verschärfen kann. Darüber hinaus erschwert eine psychosomatische Fehleinordnung der Symptome die Anerkennung einer Erwerbsminderung und eines Pflegegrads, sodass Betroffene häufig nicht die pflegerische und soziale Unterstützung erhalten, die sie benötigen.
Während einige Ärzt*innen ME/CFS immer noch als psychosomatisch einordnen und Betroffene häufig psychosomatische Fehldiagnosen erhalten, existiert unter ME/CFS-Expert*innen sowie Patientenorganisationen ein breiter Konsens, dass es sich um eine organische Erkrankung handelt. Dieser Konsens spiegelt sich auch in der Mehrzahl der Studien zu ME/CFS wider: Zwischen 1979 und 2019 beforschten die meisten Studien (80 %) zur Ätiologie von ME/CFS organische Ursachen, nur 20 % beforschten psychologische Ursachen. Dasselbe Bild zeigt sich in der Medienberichterstattung: Amerikanische Zeitungsartikel aus den Jahren 1987 bis 2013 porträtierten ME/CFS in der Mehrheit der Fälle als eine organische Erkrankung, eine Minderheit von 20 % beschrieb die Erkrankung sowohl als organisch als auch psychogen/psychosomatisch und nur 3 % der Zeitungsartikel ordneten ME/CFS als rein psychogen/psychosomatisch ein.
Wie bei anderen chronischen Krankheiten geht auch ME/CFS aufgrund der stark verminderten Lebensqualität und wegen bislang noch fehlender wirksamer/zugelassener Medikamente mit einer großen psychischen Belastung einher. Diese Belastung kann das Risiko für sekundäre psychische Erkrankungen erhöhen und z. B. eine reaktive Depression mitbedingen. Auch wenn Betroffene nicht das klinische Bild einer psychischen Erkrankung erfüllen, kann die psychische Belastung dennoch erheblich sein. Falls von den Betroffenen erwünscht, kann eine supportiv ausgerichtete Psychotherapie sinnvoll sein, um bspw. Strategien im Umgang mit dieser schweren chronischen und bislang noch nicht heilbaren Erkrankung zu erlernen. Es ist allerdings zu beachten, dass eine supportive Psychotherapie nur dann möglich ist, wenn abhängig vom Schweregrad der Erkrankung bei den Betroffenen durch die Therapiesitzungen keine nachhaltige Zustandsverschlechterung aufgrund von PEM zu erwarten ist. Hierfür ist es wichtig, dass der/die Therapeut*in mit ME/CFS vertraut ist und die individuelle Belastungsgrenze der Betroffenen konsequent berücksichtigt. Wie eine supportiv ausgerichtete Psychotherapie bei ME/CFS aussehen kann, beschreiben Grande et al. (2023) in ihrem Artikel „The Role of Psychotherapy in the Care of Patients with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome“ (Originalartikel, deutsche Übersetzung).
Fazit
Entgegen der bestehenden Meinung einiger Ärzt*innen spricht die empirische Evidenz aus 30 Jahren ME/CFS-Forschung eindeutig für eine organische Pathogenese von ME/CFS. Der Konsens in den publizierten Studien spiegelt sich auch in einem Konsens unter ME/CFS-Expert*innen und Patientenorganisationen wider. Da ME/CFS häufig noch nicht in den universitären Curricula verankert ist, fehlt in Teilen der Ärzteschaft bislang noch das Wissen zu ME/CFS. Dies manifestiert sich für Betroffene in einer prekären medizinischen Versorgungslage: In der Regel wird die Erkrankung nicht oder erst sehr spät korrekt erkannt und durch eine psychosomatische Fehleinordnung werden immer wieder kontraindizierte aktivierende Therapien angeordnet, die zu nachhaltigen Zustandsverschlechterungen führen können. Daher ist es dringend notwendig, dass ME/CFS im Medizinstudium verankert wird sowie Ärzt*innen über ME/CFS aufgeklärt werden.
Referenz:
Thoma, M.; Froehlich, L.; Hattesohl, D.B.R.; Quante, S.; Jason, L.A.; Scheibenbogen, C. Why the Psychosomatic View on Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome Is Inconsistent with Current Evidence and Harmful to Patients. Medicina 2024, 60, 83. https://doi.org/10.3390/medicina60010083
Hier geht es zur Originalstudie.
Redaktion: mth, dha, csc, squ, jhe, lfr
Beitragsbild: Une leçon clinique à la Salpêtrière von André Brouillet